Drogenpolitisches MemorandumDie Drogenpolitik in Deutschland braucht eine neue Logik -
|
| [zurück] | [Inhalt] | [vor] |
-
Hinwendung zur Subsidiarität im Drogenbereich
durch konsequentes Durchsetzen des Prinzips "Selbstbefähigung /-organisation vor Fremdbestimmung und Fremdhilfe"
-
Normalisierung der medizinischen und psychosozialen Behandlung von DrogenkonsumentInnen
Anzuerkennen ist, daß die Entwicklung von Drogenmündigkeit, wie alle sozialen Prozesse, nicht immer geradlinig verläuft, sondern von Brüchen und Phasen zeitweisen Scheiterns des einzelnen an dieser Entwicklungsaufgabe begleitet sein kann. Der dauerhafte exzessive Konsum psychoaktiver Substanzen stellt, unabhängig von deren rechtlichem Status, ein Risiko für das somatische, psychische und soziale Wohlbefinden von Menschen dar. Die physische und psychische Abhängigkeit von Drogen wird mitunter zu einer sehr komplexen und zerstörerischen Beeinträchtigung des Lebens der DrogenkonsumentInnen und ihres sozialen Umfelds, für deren Überwindung eine angemessene Unterstützung und Hilfe notwendig werden kann. Die Überlegenheit hierauf abge stimmter gesellschaftlicher Reaktionsmuster gegenüber einem strafrechtlich verfolgenden Umgang ist ausreichend bewiesen. Dennoch ist nicht zu übersehen, daß gegenwärtig viele drogenkonsumierende Menschen aus Angst vor stigmatisierender Pathologisierung und Psychiatrisierung sowie zur Verhinderung von Strafverfolgung und Ausgrenzung das medizinische Behandlungsystem meiden. In der Folge bleiben viele von ihnen in behandlungsbedürftigen Situationen ohne ärztlichen Beistand.
Um unabweisbare medizinische Hilfen bemühen sich viele DrogenkonsumentInnen bei ihren HausärztInnen. Dort werden sie allerdings nicht immer kompetent beraten und behandelt. Die derzeit mangelhafte medizinische Ausbildung führt häufig zu Unsicherheit, Unwissenheit, Vor- und Fehlurteilen, in deren Folge sich viele ÄrztInnen und auch Betreuungspersonal in Einrichtungen der Krankenversorgung weigern, DrogenkonsumentInnen zu versorgen und zu betreuen.
Die Substitutionsbehandlung Heroinabhängiger ist ein Beleg dafür, wie ärztliche Behandlung, gegebenenfalls im Zusammenwirken mit psychosozialer Betreuung, selbst bei schwerwiegenden somatischen und psychischen Erkrankungen zu einer gesundheitlichen und in der Folge auch sozialen Stabilisierung führen kann. Die gegenwärtig laufenden Programme der Methadon- und Dihydrocodeinverschreibung erreichen mehr und andere abhängige Frauen und Männer als Therapien, die vor ihrem Beginn Abstinenz von allen Opioiden fordern; sie weisen im übrigen eine hohe Haltequote auf, reduzieren deutlich die gesundheitlichen Folgeschäden des illegalisierten Heroinkonsums (unter anderm Sterblichkeit, Neuinfektionen mit Hepatitiden und HIV) und fördern die Selbsthilfepotentiale der Betroffenen. Der Erfolg der Substitutionsbehandlungen hat im Bereich der Suchtmedizin zu dem Konsens geführt, daß Drogenabhängigkeit behandelbar ist, daß sie chronisch-rezidivierend sein kann, daß Behandlung den Verlauf der Drogenabhängigkeit verbessert und die mit einer Abhängigkeit vielfach einhergehenden Komplikationen verhindert werden können.
Trotz dieser positiven Ergebnisse steht die Substitutionsbehandlung immer noch nicht allen Heroinabhängigen im notwendigen Umfang zur Verfügung. Der Zugang zu ihr wie auch ihre Durchführung sind durch eine bürokratische und praxisferne Regelungsdichte gekennzeichnet. In der Folge werden SubstitutionspatientInnen nicht wie andere PatientInnen behandelt, werden substituierende ÄrztInnen in ihrem Handeln erheblich reglementiert und strafrechtlich bedroht. Zwar definiert auch der Gesetzgeber die Sicherstellung der "medizinischen Versorgung der Bevölkerung" als eine der Maximen des BtMG (vergleiche § 5 Abs. 1 Nr. 6 BtMG); doch werden in der täglichen Praxis die Sicherheit und Kontrolle des Betäubungsmittelverkehrs regelmäßig wichtiger eingestuft als das Leben oder die Gesundheit drogengebrauchender Menschen. Dies setzt sich auch in den Regelungen der Krankenkassen fort. Die notwendige Versorgung mit einer Therapie, die sich auf Betäubungsmittel stützt, muß deshalb umgehend auch krankenversicherungsrechtlich als eine Grundversorgung anerkannt werden, für die ein gesetzlicher Sicherstellungsauftrag der Krankenkassen und Ärztevereinigungen besteht. Die vordergründige Gleichung "Heilung = Abstinenz" ist falsch; sie beinhaltet eine Logik, die schnellstens überwunden werden muß. Ein erster Schritt hierzu ist die umgehende Streichung des Abstinenzgebots, das im BtMG verankert ist. Ein zweiter Schritt wäre, den Gesichtspunkt der Überlebenssicherung als selbstverständliche Zielvorgabe auch in das Krankenversicherungsrecht (§ 27 SGB V) zu übernehmen.
Therapeutische und (andere) medizinische Angebote für DrogenkonsumentInnen müssen zugleich die Tatsache anerkennen, daß viele DrogengebraucherInnen ihren Drogenkonsum ohne professionelle Hilfe reflektieren und kontrollieren können. Diese Selbstbefähigungskompetenzen dürfen nicht dadurch behindert oder erstickt werden, daß die Bearbeitung von Drogenproblemen allein der Therapie und der Medizin zugesprochen wird. Auch vor diesem Hintergrund erweisen sich pathologisierende und psychiatrisierende Zuweisungen als ungeeignet. Vielmehr sind therapeutische und (andere) medizinische Hilfeleistungen nach dem Leitmotiv "Selbstbefähigung vor Fremdhilfe" zu strukturieren.
Wir fordern deshalb
-
die sofortige definitorische Änderung des betäubungsmittelrechtlichen Gesetzeszwecks (§ 5 Abs.1 Nr. 6 BtMG) durch die Hinzunahme des "harm-reduction"-Gedankens. Es gilt den gegenwärtigen Zweck des Gesetzes, die Sicherheit und Kontrolle des Betäubungsmittelverkehrs zu gewähren, um den Aspekt der umfassenden Gewährleistung einer kurativen, palliativen und präventiv notwendigen Versorgung der Bevölkerung zu erweitern;
-
die sofortige Beendigung direkter und indirekter Eingriffe in die Beratung und Behandlung. Die fachlich begründeten Diagnosen, Indikationen und Therapien sind in Zusammenarbeit mit den KlientInnen (die dazu befähigt werden müssen, informiert entscheiden zu können = "informed consent") zu erarbeiten und vor justiziablen Fremdeinflüssen zu schützen;
-
die sofortige Wiederherstellung der Therapiefreiheit bei der Behandlung von Abhängigen. Hierzu gehört die sofortige Beseitigung von Auflagen in bezug auf die Erlaubnis-, Antrags-, Melde-, Dokumentations- und Rezeptierpflichten der ÄrztInnen, die die Wahl und die Durchführung von Therapien für Drogenabhängige gegenwärtig erheblich beschränken. Ersatzlos zu streichen sind insbesondere jene Paragraphen, die substitierende ÄrztInnen über Bußgeld- und Strafvorschriften in der Ausgestaltung der Therapie beschränken und bei Abweichungen von gesetzlichen Vorgaben zu StraftäterInnen stempeln; diese Vorschriften schrecken vor der Aufnahme von Substitutionsbehandlungen ab (u.a. § 5 Abs. 1 BtMVV, § 13 BtMG, § 29 Abs. 1 BtMG, §§ 16, 17 BtMVV);
-
die gesetzliche Ausgestaltung der Behandlung mit Opioiden als Standardtherapie und nicht – wie bisher – deren Einstufung als Ultima-ratio-Therapie; zu schaffen sind niedrigschwellige Zugangsbedingungen für alle, die eine solche Behandlung wählen;
-
die Erweiterung der Substitutionsmöglichkeiten durch das Zulassen aller dafür geeigneten Mittel (z.B. Methadon, Polamidon, Codein, Buprenorphin) und Zubereitungen einschließlich der injizierbaren Lösungen;
-
die umgehende Überführung von Heroin in die Anlage III des BtMG, so daß es verschreibungsfähig ist; die Heroinverschreibung muß für diejenigen Heroinabhängigen möglich werden, die eine solche Behandlung wählen;
-
Anstrengungen zur Verbesserung der medizinischen Behandlung von DrogenkonsumentInnen beispielweise durch die Einführung eines obligatorischen Schwerpunkts in der Ausbildung von ÄrztInnen und KrankenpflegerInnen.
-
-
Erhaltung des Solidarprinzips in der Versorgung Drogenabhängiger
Die Verschlechterung in der sozialen Versorgung in der Bundesrepublik Deutschland trifft besonders SozialhilfeempfängerInnen und Arbeitslose, unter denen auch viele drogenkonsumierende Menschen sind. Einsparungen werden, unabhängig von wissenschaftlichen Ergebnissen und praktischen Erfahrungen, auch bei Leistungen des professionellen Hilfeystems vorgenommen, besonders bei solchen für "prognostisch ungünstige KlientInnen". Zugunsten wirtschaftlicher Erwägungen der Rentenversicherungsträger wird nicht zuletzt Stück für Stück das Mitspracherecht der KlientInnen in bezug auf die Art und den Ort der Behandlung (§ 33 SGB I) erheblich eingeschränkt und entwertet. Unter diesen gesellschaftlichen Umständen wird es für Drogenabhängige immer schwieriger, eine bedarfsgerechten Behandlung zu erhalten.
Ziel angemessener Hilfe für DrogenkonsumentInnen muß sein, diesen ein sozial integriertes, selbständiges Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen und ihnen gegebenenfalls Unterstützung bei der Entwicklung entsprechender Fähigkeiten zu gewähren. Dieses Ziel kann nicht allein durch
Drogenpolitik, sondern nur im komplexen Wirkzusammenhang von gesundheits-, sozial- und beschäftigungspolitischen Maßnahmen erreicht werden. Gegenwärtig wird jedoch die notwendige Verknüpfung medizinischer Rehabilitationsleistungen mit alltagspraktischen und psychosozialen Eingliederungsangeboten, die hauptsächlich von den Ländern und Kommunen über das Bundessozialhilfegesetz (BSHG) zu finanzieren sind, schon in ihren Ansätzen wieder zerstört oder zumindest erheblich erschwert.
Wir fordern deshalb
-
bei der Reformierung der Finanzierung von Unterstützungs- und Behandlungsmaßnahmen für DrogenkonsumentInnen und -abhängige das Solidarprinzip strikt zu wahren und die Zugangsbedingungen zu entsprechenden Hilfen unbürokratisch und niedrigschwellig zu gestalten;
-
dazu gehört die umgehende Neuordnung der Finanzierung von Hilfen für DrogenkonsumentInnen im Rahmen eines Artikelgesetzes, so daß soziale und gesundheitliche Unterstützung schnell und unbürokratisch gewährleistet werden kann;
-
gefordert ist ein bundesweites Initiieren von "Vorleistungskassen", über die Hilfemaßnahmen unbürokratisch vorfinanziert werden können, so daß die Verhandlungen mit den verantwortlichen Leistungsträgern im nachhinein und abgekoppelt von akuten Problemsituationen erfolgen können;
-
-
umfangreiche Modellprogramme für Arbeits- und Beschäftigungsprojekte zur sozialen Wiedereingliederung drogenkonsumierender Frauen und Männer über die Neufassung von Leistungsgesetzen, durch die tatsächlich abrufbare Hilfen über das BSHG, Maßnahmen der Krankenkassen, Rentenversicherungsträger und des Arbeitsförderungsgesetzes bereitgestellt werden;
-
Steuern und Abgaben aus dem Verkauf psychoaktiver Substanzen (zum Beispiel Tabak, Alkohol, Medikamente) gezielt zu verwenden, um damit sowohl Maßnahmen der Prävention, als auch Hilfe- und Unterstützungsmaßnahmen für Drogenabhängige zu finanzieren.
-
-
Repression: Haft/Justiz ("harm-reduction")
Im Zuge eines drogenpolitischen Paradigmenwechsels hin zu einer gesellschaftlichen Förderung von Drogenmündigkeit und Drogenkompetenzen darf nicht übersehen werden, daß es auch Regelungen geben muß, mit denen Fremdgefährdungen und Fremdschädigungen durch Drogenkonsum wirksam unterbunden werden. Entsprechende Maßnahmen der Regulierung des Verhaltens einzelner haben sich im Rahmen der Regelung sozialer Grundnormen über Jahrhunderte entwickelt und sind im bestehenden Strafrecht bereits ausreichend festgeschrieben. Eine darüber hinausgehende Sonderregelung für Drogendelinquenz ist deshalb nicht nur unnötig, sondern auch verfassungsrechtlich äußerst problematisch.
Die Law-and-order-Mentalität auf den kommunalen, regionalen und bundespolitischen Entscheidungsebenen ist auch in drogenpolitischen Zusammenhängen längst nicht mehr mit rechtstaatlichen Grundsätzen vereinbar. Belästigung, mangelnde Sauberkeit und "Unwirtlichkeit" bundesdeutscher Großstädte dienen als Alibi, um polizeiliche und ordnungsbehördliche Befugnisse beinahe uferlos auszudehnen. Betroffen ist ein Personenkreis, der gemeinhin als gesellschaftlich "randständig" betrachtet wird.
Diese Fehlentwicklungen sind umgehend zu beenden. Es gilt, die polizeiliche Arbeit neu zu systematisieren, auf ihre rechtstaatlich unverzichtbare Funktion zurückzuführen und den Geboten der Objektivität, Transparenz und Verhältnismäßigkeit unterzuordnen: Abweichendes Verhalten ist nicht schon deshalb polizeilich oder ordnungsbehördlich relevant, weil es von gesellschaftlichen Normen abweicht. Erst wenn konkrete Rechtsnormen gebrochen werden oder konkrete Gefahren abzuwehren sind, ist polizeiliches Einschreiten zu rechtfertigen. Das Rechtsgut "öffentliche Sicherheit und Ordnung" und die polizeiliche Befugnis der "Gefahrenabwehr" sind demnach in einem objektivierbaren, eng umrissenen Sinne auszulegen. In den Polizeigesetzen der Bundesländer sollte zugleich eine Antidiskriminierungsklausel eingefügt werden, wonach im öffentlichen Raum gezeigte abweichende Lebensstile nicht per se eine Störung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung darstellen.
Die polizeiliche Tätigkeit muß im Drogenbereich zugleich wieder mehr Transparenz erhalten. Die BürgerInnen müssen erkennen oder vorhersehen können, wann sie AdressatInnen einer polizeilichen Maßnahme sind. Dementsprechend müssen die Kriterien polizeilichen Handelns klar benannt und bekannt sein. Bei einem Wegfall der Strafbarkeit von derzeit im BtMG strafbedrohten Taten und einem eingeschränkten Verständnis von "öffentlicher Ordnung" reduzieren sich künftig die Anlässe für polizeiliche Maßnahmen gegen drogengebrauchende Personen deutlich. Die Widersprüche in den Handlungsaufträgen von Polizei, Schule und Jugendarbeit erfordern zugleich, künftig auch auf die bedenkliche Ausweitung der polizeilichen Tätigkeit etwa in die Bereiche der schulischen und außerschulischen Suchtprävention bei Jugendlichen zu verzichten.
Das deutsche Strafvollzugssystem, das die ihm zukommende Aufgabe der Resozialisierung straffällig Gewordener durch seine einseitige Ausrichtung an den Sicherheitsinteressen der Allgemeinheit vielfach konterkariert, bedroht mit seinen sozialen und materiellen Rahmenbedingungen die Gesundheit der Gefangenen auf besondere Weise. Seine Ursachen findet dies nicht nur in den ohnehin krankheitsfördernden Aspekten des Lebens in Haft. Die Bedrohung der Gesundheit der Gefangenen durch die Bedingungen der Haft erhält besondere Brisanz angesichts von Infektionen und übertragbaren Krankheiten wie HIV, AIDS, Hepatitiden und ähnliche, die die Lebensqualität und auch die Lebensperspektiven von Gefangenen dramatisch einschränken.
Der zwangsverwahrende und von struktureller Gewalt gekennzeichnete Charakter des Strafvollzugs begrenzt nicht nur die Möglichkeiten einer selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Lebensgestaltung als Voraussetzung eines gesundheitsbewußten Handelns der Gefangenen. Er schränkt auch das Engagement anderer Institutionen für Gesundheitsförderung unter Gefangenen ein: Nach wie vor werden den InsassInnen von Strafanstalten notwendige Informationen und Beratungen zu Infektions- und anderen Erkrankungsrisiken sowie zu gebotenen Vorsichtsmaßnahmen versagt, werden notwendige Präventionsmittel (zum Beispiel Kondome, Gleitmittel, sterile Spritzbestecke) verwehrt. Das Fehlen der freien Arztwahl, der mangelnde Einbezug externer FachärztInnen und -kliniken sowie erhebliche Einschränkungen bei der psychosozialen Begleitung und medizinischen Behandlung treffen drogenkonsumierende Gefangene und damit die Mehrheit der InsassInnen von Strafanstalten auf besondere Weise und geben dem Thema "HIV und AIDS im Strafvollzug" einen extraordinären Stellenwert.
Die Illegalisierung und Kriminalisierung des Konsums bestimmter psychoaktiver Substanzen sind dafür verantwortlich, daß die Haftanstalten, in denen heute schon 30 bis 50% der Gefangenen drogenabhängig und alkoholkrank sind, eine stetig steigende Zahl von Verurteilten aufnehmen müssen, die gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen haben und/oder in Zusammenhang mit ihrer Drogenabhängigkeit straffällig wurden. Intravenös konsumierende DrogengebraucherInnen sind mit einem zweifachen Übertragungsrisiko – erstens in Zusammenhang mit Sexualität, zweitens mit Drogenkonsum – ohnehin erhöhten Infektionsrisiken ausgesetzt, die sich unter den rigiden Bedingungen des Strafvollzugs noch verschärfen. Diesen stehen in der Regel minimale Hilfe- und Unterstützungsangebote gegenüber, die sich nicht mit dem Standard des Hilfesystems außerhalb von Haftanstalten (zum Beispiel Entgiftungsmöglichkeiten, Aufnahme oder Weiterführung einer Substitutionsbehandlung) messen können. Die Erfahrungen zeigen zugleich, daß eine Zwangstherapie gemäß § 64 (Maßregelvollzug) wenig erfolgversprechend ist, weil Psychotherapie unter Zwang nicht funktionieren kann.
Wir fordern deshalb
-
den Maßregelvollzug in der jetzigen Form abzuschaffen;
-
gesetzliche Grundlagen zu schaffen, die nationale Minimalanforderungen an die Möglichkeiten der Gesundheitsförderung, Hilfe- und Unterstützung sowie medizinischen Behandlung in den Justizvollzugsanstalten festschreiben und damit in allen Einrichtungen Anwendung finden. Diese müssen hinwirken
-
auf die bundesweite Durchsetzung einer ungehinderten Verbreitung der Botschaften von Safer Use und Safer Sex in Strafvollzugsanstalten, in denen drogenkonsumierende Gefangene leben;
-
auf die bundesweite Anerkennung der Notwendigkeit und der Verpflichtung der Justiz, jedem/r Gefangenen die außerhalb des Vollzugs üblichen infektionsprophylaktischen und gesundheitsfördernden Maßnahmen zugänglich zu machen. Diese Maßnahmen müssen geeignet sein, die Gesundheit eines/r jeden Gefangenen zu erhalten. Dies schließt Spritzen- und Kondomvergabe als Standard der Gesundheitsförderung in Haft ein;
-
auf die bundesweite Sicherstellung der Kontinuität der Behandlung bei Neueintritt und Entlassung drogenkonsumierender Gefangener (zum Beispiel Substitutionsbehandlung, Beibehaltung einer bestimmten Medikation wie Naltrexon). Dies orientiert auf einen Ausbau der Zusammenarbeit zwischen Gefängnissen und außervollzuglichen Diensten;
-
auf die Schaffung von Behandlungsangeboten, die in ihren Zugangsmöglichkeiten und Qualitätsstandards denen außerhalb des Gefängnisses entsprechen;
-
-
bundesweit darauf hinzuwirken, daß bei Bediensteten und Inhaftierten, bei juristischen und politischen EntscheidungsträgerInnen und in der Öffentlichkeit eine Akzeptanzhaltung gegenüber erfolgversprechenden instrumentellen und personalkommunikativen Präventionsangeboten geschaffen und aufrechterhalten wird. Das Thema "selbstverantwortlicher Drogenkonsum" muß deshalb obligatorischer Bestandteil der Aus- und Fortbildung dieses Personenkreises sein;
-
Modellprogramme zur Heroinverschreibung auch für Strafgefangene.
-
| [zurück] | [Inhalt] | [vor] |
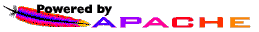

|
© 1999-2012 by Eve & Rave Webteam webteam@eve-rave.net |